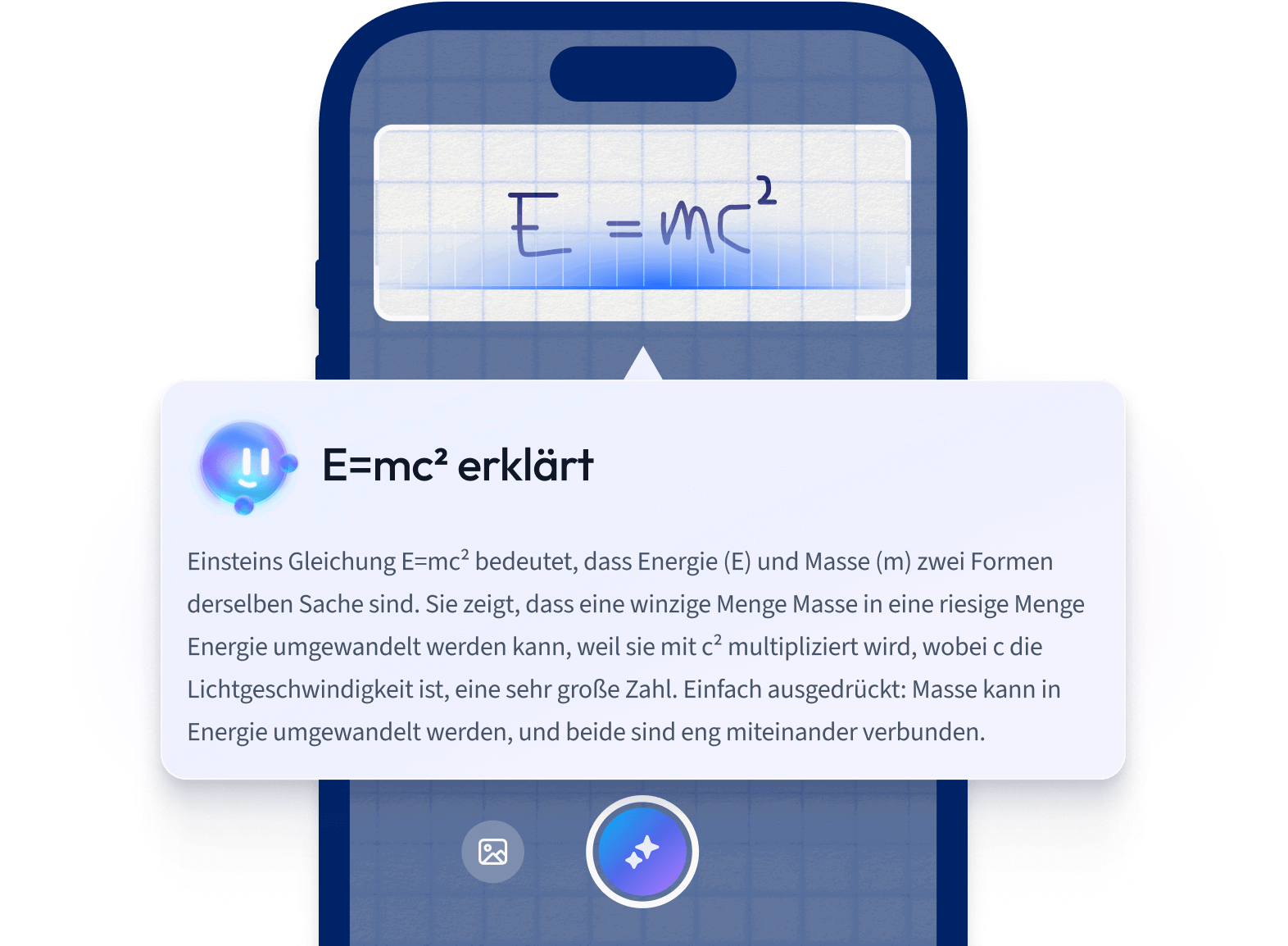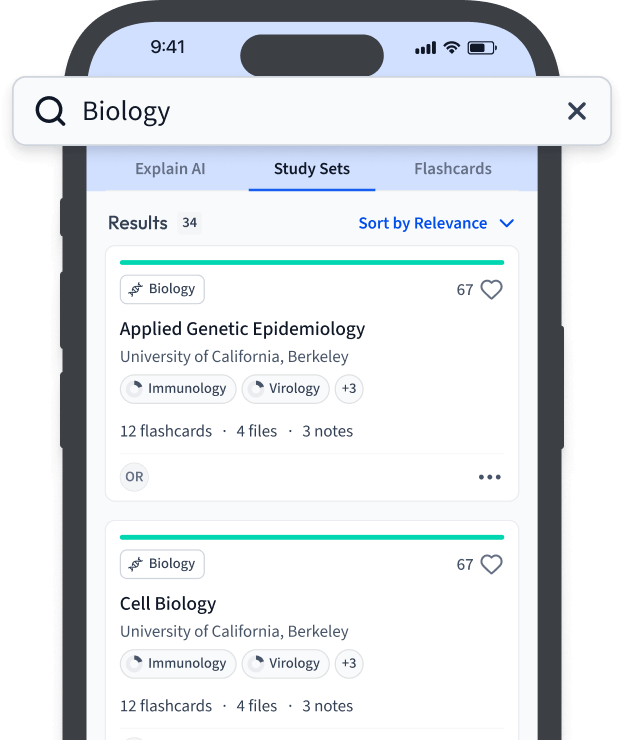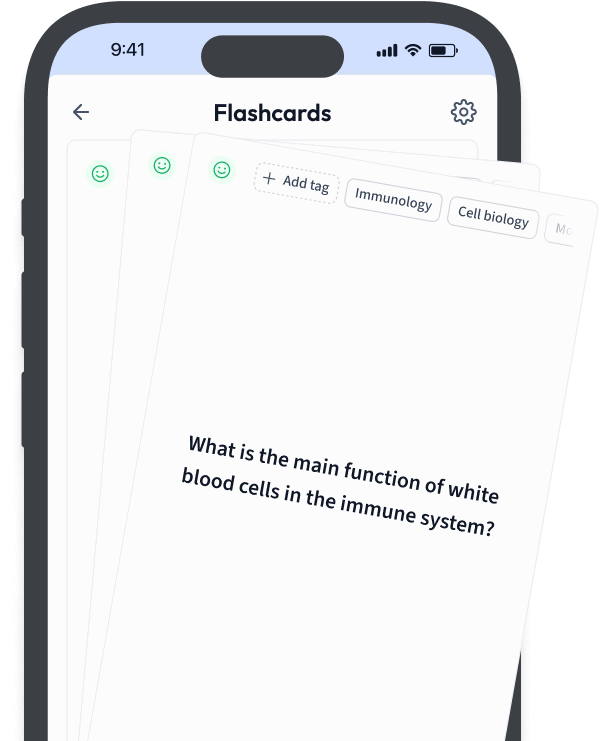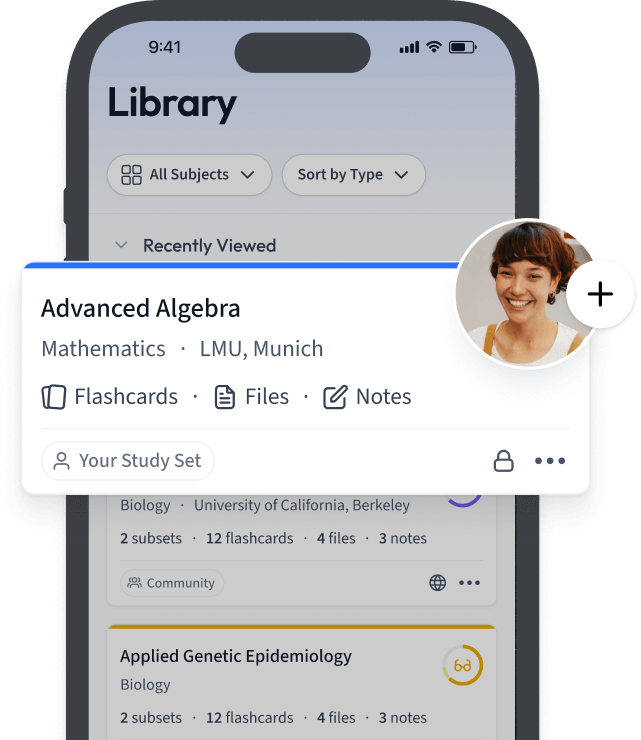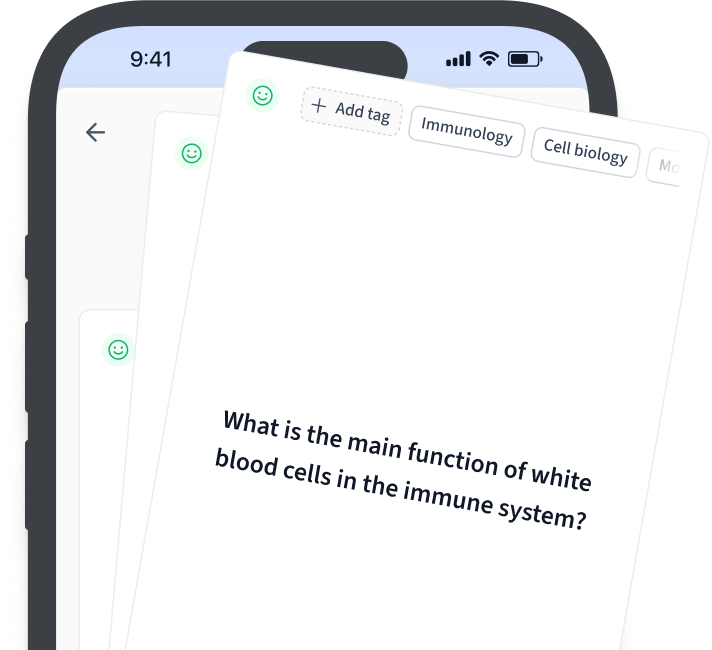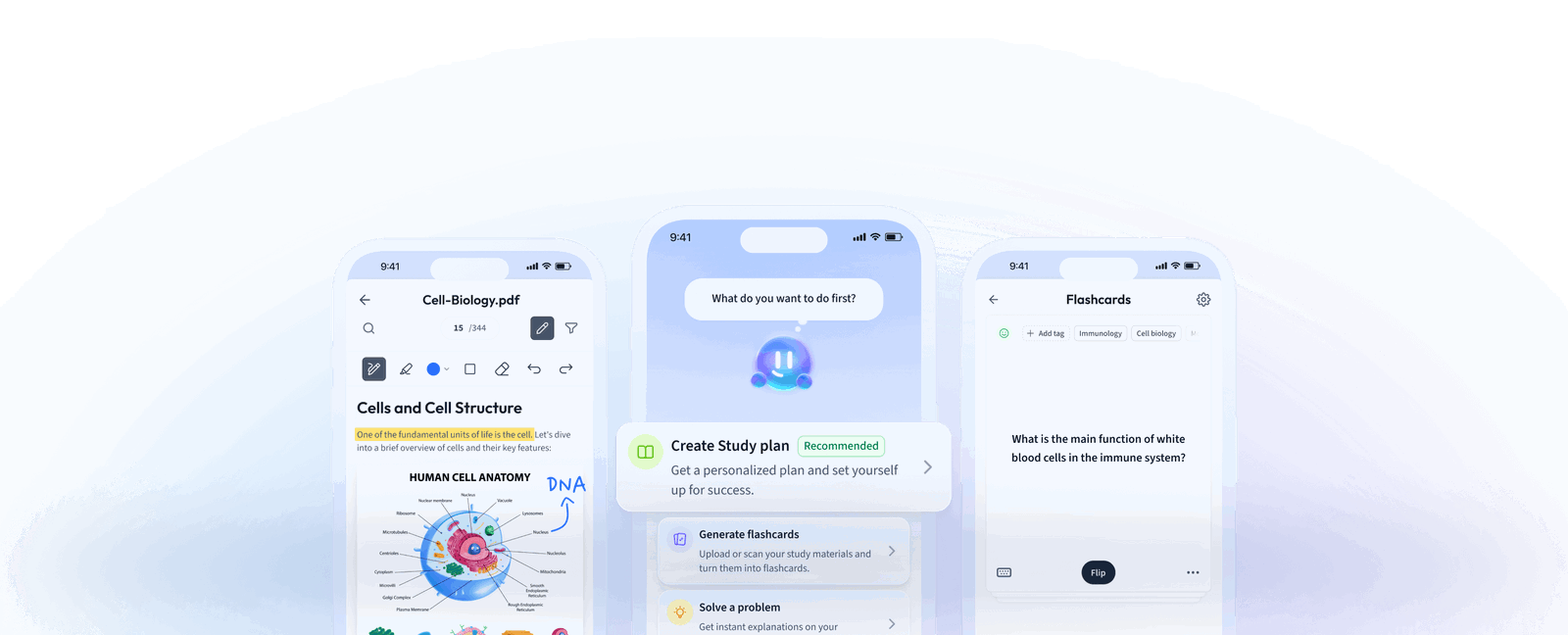Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals war der Kalte Krieg in vollem Gange. Die Westmächte, angeführt von den USA, standen mit dem sogenannten Ostblock, angeführt von der Sowjetunion, im Konflikt. Fragen im Bezug auf das geteilte Deutschland und die konkurrierenden politischen Systeme belasteten die Beziehung zwischen Westen und Osten.
Um mehr über den Kalten Krieg zu erfahren, kannst du gerne auch unsere anderen Zusammenfassungen auf StudySmarter lesen!
Die Anfänge der KSZE
Zunächst erfährst du was zu der KSZE geführt hat und was vor dem KSZE Prozess geschehen ist.
Die Idee der KSZE
Die Grundidee der Konferenz, war eine Entspannungspolitik. Mit dem Ziel die Beziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten zu verbessern, kam die KSZE zustande. Außerdem sollte durch die Zusammenarbeit, der Entspannungsprozess in Europa, sowie das Vertrauen untereinander gefördert werden. Neben der Zusammenarbeit im Kulturbereich, der Wissenschaft, Wirtschaft und Abrüstung wollte die KSZE sich mit der Sicherung und Durchsetzung der Menschenrechte befassen.
In unserer Zusammenfassung zum ABM-Vertrag erfährst du Genaueres zum Thema Entspannungspolitik nach dem Kalten Krieg!
Das Budapester Appell
Der Warschauer Pakt hatte bereits 1967 die Idee eine KSZE zu veranstalten. Dabei sollten die Allianzen NATO und Warschauer Pakt aufgelöst werden. Außerdem wollte der Warschauer Pakt die nicht-europäischen USA nicht mehr miteinbeziehen. 1969 bestärkte der Warschauer Pakt mit dem Budapester Appell die Dringlichkeit einer Konferenz der europäischen Staaten, unabhängig davon welchem Block im Kalten Krieg diese Staaten angehörten.
Hürden für die KSZE
Die Westmächte waren erstmal gegen eine Zusammenarbeit in Form einer KSZE. Im Westen befürchtete man, dass Verhandlungen in dieser Richtung das Ansehen der deutschen Teilung steigern und die Teilung stärken könnten. Der NATO-Rat ließ sich 1970 auf den Vorschlag der KSZE ein.
Vorbedingungen der KSZE
Zuerst mussten allerdings Fortschritte in den Verhandlungen über Deutschland und den Status Berlins gewährleistet sein. Nachdem weltweit Entspannungspolitik betrieben und sowohl die Ostverträge als auch der Grundlagenvertrag geschlossen wurde, wollten die Staaten des Warschauer Pakts und der NATO Mitte der 1970er Jahre ihre Zusammenarbeit stärken. Der Weg für die KSZE war frei. Vorgespräche zur KSZE wurden ab 1972 geführt.
Auch zum Grundlagenvertrag und und den Ostverträgen findest du interessante Zusammenfassungen auf StudySmarter!
KSZE Prozess
Was bis zu der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki passiert ist und wer an den Verhandlungen des KSZE Prozess beteiligt war, erfährst du im folgenden Abschnitt. Am 22. November 1972 fand in Dipoli nahe Helsinki eine Konferenz statt, die in insgesamt vier Runden bis Juni 1973 einen Leitfaden für die KSZE entwickelte. Die KSZE wurde dabei in drei Phasen gegliedert.
Phasen der KSZE
Zuerst sollte eine Außenministerkonferenz abgehalten werden, die Verfahrensregeln, die Tagesordnungspunkte und die Zielsetzung für die Folgearbeit in Kommissionen besprechen sollte. Darauf sollte eine Kommissionsphase folgen. In der Schlussphase sollten die erarbeiteten Dokumente festgehalten werden. Da diese Dokumente dann auch in einer gemeinsamen Schlussakte verabschiedet werden sollten, wird von der KSZE Schlussakte oder auch Schlussakte von Helsinki und nicht von einem Vertrag gesprochen.
KSZE Konferenz
Am 3. Juli 1973 wurde die KSZE in Helsinki eröffnet. An der KSZE in Helsinki nahmen insgesamt 35 Staaten teil. Von den Teilnehmerstaaten der Konferenz gehörten sieben Staaten dem Warschauer Pakt an, 13 Länder waren neutral gestellt und 15 Staaten waren der NATO zugehörig. Bis auf Albanien nahmen sowohl alle europäischen Staaten als auch die Sowjetunion, die USA und Kanada an der KSZE teil. Die USA und Kanada wurden auf die Initiative der Staaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) zu der Konferenz in Helsinki eingeladen.
Wenn du dich näher für die Entstehung Europas interessierst, lies auch unsere Zusammenfassungen zur Europäischen Integration auf StudySmarter!
KSZE Schlussakte
Über zwei Jahre hinweg wurden in Genf während der Kommissionsphase Verhandlungen zur KSZE Schlussakte geführt. Am 1. August 1975 wurde die KSZE Schlussakte dann schließlich in Helsinki unterschrieben. In der Schlussakte einigten sich die Staaten auf zehn Prinzipien, die sie in ihrer Zusammenarbeit berücksichtigen wollten. Diese ließen sich in drei Bereiche gliedern: Regelungen zu Fragen der Abrüstung, das Ziel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten.
Die zehn Prinzipien der Schlussakte von Helsinki
In der KSZE Schlussakte von Helsinki vereinbarten die teilnehmenden Staaten folgende Punkte:
- ihre souveräne Gleichheit sowie die ihrer Souveränität innewohnenden Rechte zu achten
- auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt zu verzichten
- die Grenzen nicht zu überschreiten und die territoriale Integrität aller Teilnehmerstaaten zu achten
- Streitfälle friedlich zu regeln
- sich nicht in die inneren Angelegenheiten der anderen Teilnehmerstaaten einzumischen
- die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu garantieren
- die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker zu achten
- ihre Zusammenarbeit gemäß der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen zu entwickeln
- ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen nach Treu und Glauben zu erfüllen
Außerdem wollten die Teilnehmenden der Konferenz
wirtschaftlich, wissenschaftlich und technisch sowie in Bezug auf
Militär und Umwelt zusammenarbeiten.
KSZE Bedeutung
Die Schlussakte von Helsinki wurde insgesamt im Osten und Westen als Erfolg verbucht. Für die Staaten des Warschauer Paktes regelte die Schlussakte der Konferenz von Helsinki die Unverletzlichkeit ihres Territoriums und ihrer Staatsgrenzen. Der Westen befürwortete die Entwicklung hin zu der Einhaltung der Menschenrechte im Osten.
Helsinki-Gruppen
Für viele Bürgerrechtsbewegungen im Osten, wie zum Beispiel die "Solidarność" in Polen, wurden die Vereinbarungen aus der KSZE Schlussakte die Basis ihres Protests. Wegen dieser sogenannten Helsinki-Gruppen wurde die KSZE Schlussakte für die Sowjetunion problematisch, da sie einen Schritt gegen den Kommunismus darstellte.
Die Bedeutung der KSZE für DDR und BRD
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) durften beide gleichermaßen an der KSZE teilnehmen. Das SED-Regime der DDR erreichte durch die Konferenz internationale Anerkennung. Besonders wichtig für die DDR war es, dass sie in Europa soweit anerkannt wurde, dass sich niemand mehr in innere Angelegenheiten einmischen würde. Doch selbst nachdem die KSZE Schlussakte von Helsinki unterschrieben war, wurden die Menschenrechte in der DDR nicht geachtet. Die CDU/CSU-Opposition im Bundestag nahm das zum Anlass die KSZE zu kritisieren. Die Übereinkünfte aus der Schlussakte von Helsinki sah sie als verzerrte Abbildung der Wirklichkeit.
Abb. 1: Helmut Schmidt(BRD) und Erich Honecker (DDR) bei der Unterzeichnung der KSZE Schlussakte am 1. August 1975, Quelle: BpB.de
Umsetzung der KSZE Schlussakte
Es war geplant in weiteren Konferenzen zu prüfen, inwiefern die einzelnen Länder die KSZE Schlussakte von Helsinki umsetzten. Die KSZE Schlussakte basierte lediglich auf der Selbstverpflichtung und war kein fester Vertrag. Nach der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki wurden Konferenzen in Belgrad (1977-1978), Madrid (1980-1983) und Wien (1986-1989) abgehalten. Die KSZE veranlasste Osten und Westen miteinander zu kooperieren. Die Zusammenarbeit stärkte das Vertrauen zwischen den beiden Blöcken und war ein wichtiger Schritt zum Ende des Ost-West-Konfliktes.
Die Charta von Paris 1990
Am 21. November 1990 wurde die "Charta von Paris für ein neues Europa" verabschiedet. Damit sollte auf den historischen Wechsel nach dem Kalten Krieg eingegangen werden. Um diesen auszugestalten und neue Herausforderungen zu meistern, war ein Institutionalisierungsprozess nötig. Langfristige Institutionen für die Zusammenarbeit sollten geschaffen werden.
Auflösung der KSZE
So wurde auch die KSZE 1994 aufgelöst. Doch die Ziele der KSZE Schlussakte sollten durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa weiterverfolgt werden. Die KSZE wurde also von einer Konferenz in eine Organisationsform übertragen. Die Schlussakte von Helsinki blieb die Grundlage für die OSZE, die bis heute existiert. Die offizielle Umbenennung erfolgte 1995.
Die OSZE
Die OSZE setzt sich aus 57 nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Mitgliedstaaten zusammen. Als regionale Sicherheitsorganisation setzt sich die OSZE zum Ziel durch Zusammenarbeit Sicherheit zu schaffen und Konflikte nicht nur zu verhüten, sondern auch mit vorhandenen Konflikten umzugehen. Außerdem gehört der Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, sowie Abrüstung und Terrorismusbekämpfung zu den Zielen der OSZE.
Abb. 2: Flaggen der OSZE Teilnehmerstaaten, Quelle: osce.org
Kooperationen der OSZE
Anfang der 1990er Jahre begann die OSZE – nach Vorbild der NATO und der EU – die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in die Wege zu leiten. Dafür wurde der Dialog auf Expertenebene gefördert und Seminare veranstaltet. So wollte die OSZE den Meinungsaustausch und die Zusammenarbeit im Bereich der "kooperativen Sicherheit" ausbauen. Die Kooperationspartner sind jedoch kein direkter Teil der OSZE.
Kooperationspartner der OSZE im Mittelmeerraum
Die OSZE führt mit ihren Kooperationspartnern einen Dialog über ihren ganzen Tätigkeitsbereich. Jede Gruppe von Kooperationspartnern beschäftigt sich mit den wichtigsten Berührungspunkten in der Zusammenarbeit und gemeinsamen Interessen. Mit den Dialogpartnern im Mittelmeerraum stehen vor allem Terrorismusbekämpfung, Grenzsicherung, Wasserbewirtschaftung, Aufgaben der Umweltsicherheit, Migrationssteuerung, der interkulturelle und interreligiöse Dialog, sowie Toleranz und Nichtdiskriminierung auf der Agenda. Als Kooperationspartner der OSZE im Mittelmeerraum verstehen sich Ägypten, Algerien, Israel, Jordanien, Marokko und Tunesien.
Die asiatischen Kooperationspartner
Afghanistan, Australien, Japan, die Republik Korea und Thailand gehören zu den asiatischen Kooperationspartnern der OSZE. In Asien fokussieren die Kooperationspartner vor allem das Thema Sicherheit. Die OSZE bemüht sich den Dialog über vertrauensstärkende und sicherheitsbildende Maßnahmen zu stärken.
Angestoßen davon wollen die Kooperationspartner ihre eigene Region sicherer gestalten. Weitere Schwerpunkte der Zusammenarbeit bilden der Umgang mit internationalen Bedrohungen und das Grenzmanagement. Außerdem werden Verkehrsfragen, die Bekämpfung des Menschenhandels, der Aufbau demokratischer Institutionen und die Abwicklung von Wahlen als wichtige Bereiche eingestuft. So stellt die OSZE zum Beispiel bei Bundestagswahlen Wahlbeobachter bereit. Sie beobachten, ob bei der Vorbereitung und der Durchführung der Bundestagswahlen sowie bei der Stimmenauszählung alle Regelungen eingehalten werden.
Prozesse innerhalb der OSZE
Seit der Verabschiedung der "Europäischen Sicherheitscharta von Istanbul" 1999 müssen alle Teilnehmerstaaten der OSZE ihre Beziehungen untereinander und den Umgang innerhalb ihrer Gesellschaft offenlegen.
Im folgenden Abschnitt erhältst du einen Einblick in die Abläufe in der OSZE.
Der Ministerrat der OSZE
Der Ministerrat fasst die Beschlüsse in der OSZE und ist ihr leitendes Organ. Meistens wird jährlich ein Ministerratstreffen im Land des Vorsitzenden organisiert. Der Ministerrat setzt sich aus den Außenministern der OSZE-Teilnehmerstaaten zusammen. Zwischen den Gipfeltreffen werden die Entscheidungen und Absprachen der OSZE im Ministerrat getroffen.
Vorsitz der OSZE
Der Staat, der den OSZE-Vorsitz bereitstellt, wird durch den Ministerrat bestimmt. Begrenzt auf ein Kalenderjahr übernimmt der Außenminister dieses Staates die Rolle des amtierenden Vorsitzenden. In den Gipfeltreffen der OSZE werden die Schwerpunkte der Organisation besprochen. Dafür setzen sich die Staats- und Regierungschefs der OSZE-Teilnehmerstaaten zusammen und stimmen über die Tendenzen der Organisation für die nächsten Jahre ab. Wie häufig solche Gipfeltreffen stattfinden ist nicht festgelegt.
Gipfeltreffen der OSZE
Alle Staaten innerhalb der OSZE können ein Gipfeltreffen vorschlagen. Wenn die Teilnehmerstaaten den Beschluss zu einem Gipfeltreffen einvernehmlich angenommen haben, kann dieses abgehalten werden. Vor den Gipfeltreffen werden Überprüfungskonferenzen abgehalten. Darin wird ein Überblick über den gesamten Tätigkeitsbereich der Organisation gewonnen und ein beschlussfähiges Dokument herausgearbeitet. Dieses Dokument wird im Gipfeltreffen verabschiedet.
KSZE - Das Wichtigste auf einen Blick
- Warschauer Pakt schlug Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in den 1960er Jahren vor → Westen war noch nicht bereit
- Grundlagenvertrag und die Ostverträge regelten Situation Deutschlands und den Status Berlins → Westen stimmte KSZE zu
- 1972 Vorgespräche zur KSZE
- zwei Jahre Verhandlungen zur KSZE Schlussakte in Genf
- 1. August 1975 wurde die KSZE Schlussakte in Helsinki unterschrieben → zehn Prinzipien, für ihre Zusammenarbeit: Regelungen zu Fragen der Abrüstung, das Ziel der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und die Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten
- 21. November 1990 "Charta von Paris für ein neues Europa" → Wechsel und Institutionalisierung nach dem Kalten Krieg: aus Konferenz- wurde eine Organisationsform
- 1995 Umbenennung in OSZE → als Nachfolgeorganisation der KSZE bis heute aktiv
Wie stellen wir sicher, dass unser Content korrekt und vertrauenswürdig ist?
Bei StudySmarter haben wir eine Lernplattform geschaffen, die Millionen von Studierende unterstützt. Lerne die Menschen kennen, die hart daran arbeiten, Fakten basierten Content zu liefern und sicherzustellen, dass er überprüft wird.
Content-Erstellungsprozess:
Lily Hulatt ist Digital Content Specialist mit über drei Jahren Erfahrung in Content-Strategie und Curriculum-Design. Sie hat 2022 ihren Doktortitel in Englischer Literatur an der Durham University erhalten, dort auch im Fachbereich Englische Studien unterrichtet und an verschiedenen Veröffentlichungen mitgewirkt. Lily ist Expertin für Englische Literatur, Englische Sprache, Geschichte und Philosophie.
Lerne Lily
kennen
Inhaltliche Qualität geprüft von:
Gabriel Freitas ist AI Engineer mit solider Erfahrung in Softwareentwicklung, maschinellen Lernalgorithmen und generativer KI, einschließlich Anwendungen großer Sprachmodelle (LLMs). Er hat Elektrotechnik an der Universität von São Paulo studiert und macht aktuell seinen MSc in Computertechnik an der Universität von Campinas mit Schwerpunkt auf maschinellem Lernen. Gabriel hat einen starken Hintergrund in Software-Engineering und hat an Projekten zu Computer Vision, Embedded AI und LLM-Anwendungen gearbeitet.
Lerne Gabriel
kennen