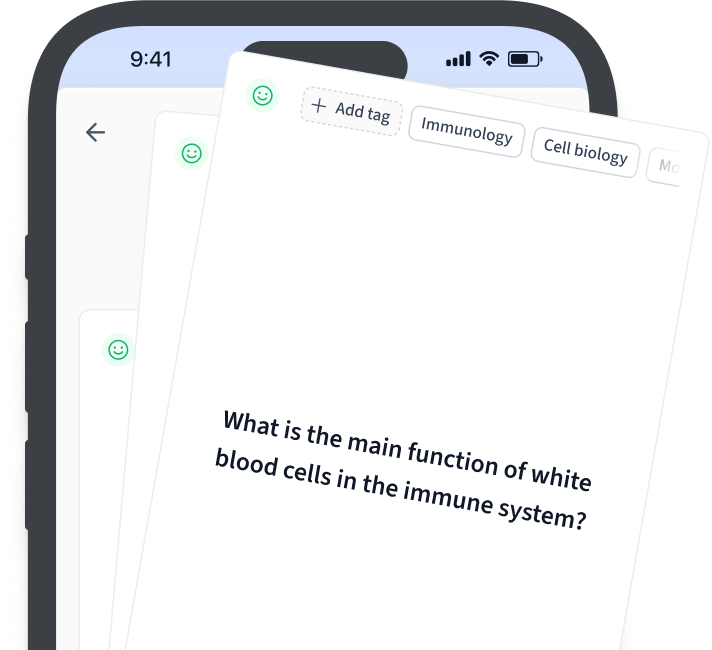Deeskalation – Definition
Die Psychologie hat eine ziemlich klare Vorstellung davon, was Deeskalation eigentlich ist und was sie alles miteinschließt. Die Definition lautet folgendermaßen:
Bei der Deeskalation handelt es sich um eine Maßnahme bzw. Methode zur Verhinderung der Entstehung oder Steigerung von Aggression und Gewalt. Ziel von Deeskalation ist die Verhinderung von physischen und psychischen Schäden.
Deeskalation ist somit das Gegenteil der sogenannten Eskalation und versucht diese bzw. Aggression zu verhindern. Der Vorgang der Eskalation lässt sich wie folgt definieren:
Eskalation meint die Verstärkung eines Konflikts durch sich wechselseitig anstachelnde Aktionen und Reaktionen. Ausgelöst wird Eskalation i. d. R. durch Aggression, Macht, Gewalt und herausforderndes Verhalten.
Sowohl bei der Deeskalation als auch bei der Eskalation handelt es sich um Verhaltensmuster, die bewusst, aber auch intuitiv von einer Person eingesetzt werden können. Beide Prozesse erfordern immer mindestens zwei Konfliktparteien und beschränken sich nicht ausschließlich auf (Privat-) Personen. Eskalation und Deeskalation kann auch zwischen Organisationen, Staaten oder Gesellschaftsschichten stattfinden, wie dieses Beispiel verdeutlicht:
Nehmen wir einen Shitstorm, also eine lawinenartig auftretende negative Kritik in den sozialen Medien, die sich immer stärker emotionalisiert und verselbstständigt. Bei einem Shitstorm kommt es zu einer Eskalation zwischen einem Unternehmen/ Organisation/ politischer Partei und mehreren Personen einer oder mehrerer gesellschaftlicher Schichten.
Deeskalation – Synonym
Häufig wird Deeskalation mit Bezeichnungen wie beschwichtigen, zurückrudern oder auch besänftigen gleichgesetzt. Entschärfst Du eine Konfliktsituation, betreibst Du im Grunde nichts anderes als Deeskalation.
Deeskalation – Bedeutung
Bei der Erforschung von Eskalation gilt der Konfliktforscher Friedrich Glasl als einer der Pioniere mit seinem Stufenmodell der Eskalation. In diesem Modell führt der Österreicher insgesamt drei Eskalationsstufen und neun Eskalationsphasen auf. Es dient der Analyse von Konflikten und somit als Hilfestellung bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Deeskalation.
Bei dem Modell handelt es sich bewusst um eine absteigende statt aufsteigende Treppe, da Friedrich der Ansicht ist, dass bei einer Eskalation Energien freigesetzt werden, die sich jeglicher menschlicher Beherrschung und Steuerung entziehen und von unvorstellbarer niederer Kraft sind. Sie ziehen den Menschen also "mit sich in die Tiefe bzw. den Abgrund".
 Abbildung 1: Übersicht über die drei Stufen und neun Phasen der Konflikteskalation nach F. Glasl
Abbildung 1: Übersicht über die drei Stufen und neun Phasen der Konflikteskalation nach F. Glasl
Die Abbildung verdeutlicht die einzelnen Stufen (I – III) und Phasen (1 – 9).
Die erste Stufe (win–win) zeigt, dass beide Konfliktparteien noch in der Lage sind, den Konflikt zu gewinnen.
In der zweiten Stufe (win–lose) hat eine der beiden Parteien bereits verloren.
In der letzten Stufe (lose–lose) gehen beide Konfliktparteien schließlich als Verlierer aus der Auseinandersetzung heraus.
Getrennt werden die drei Stufen durch sogenannte Hauptschwellen. Sind diese einmal überschritten, gibt es kein Zurück mehr zu der letzten Stufe.
I. Stufe: "Alles ist offen"
- 1. Phase: Verhärtung
- Spannungen, z. B. durch gelegentliche Auseinandersetzungen im Alltag
- wird nicht als Beginn eines Konflikts wahrgenommen
- 2. Phase: Debatte
- Ausarbeitung von Strategien zur Überzeugung des Konfliktpartners von der eigenen Meinung
- Entstehung von Streit und Druckausübung zwischen den Konfliktparteien
- Entstehung von Schwarz-Weiß-Denken
- 3. Phase: Taten statt Worte
- Verstärkung des gegenseitigen Drucks
- Abbruch von Gesprächen und verbaler Kommunikation
- Empathie und Mitgefühl geht verloren
→ Hauptschwelle: Sicherung einer sachlichen und kooperativen Lösung zwischen den Parteien.
II. Stufe: "Verlierer und Gewinner"
- 4. Phase: Sorge um Koalitionen und das Image
- Suche nach Sympathisanten zur Unterstützung der eigenen Meinung
- Gewinn des Konflikts von nun an im Mittelpunkt der Auseinandersetzung
- 5. Phase: Gesichtsverlust
- Vernichtung der Identität der anderen Konfliktpartei
- Vollständiger Vertrauensverlust
- Verlust der moralischen Glaubwürdigkeit
- 6. Phase: Drohstrategien
- Versuch der Kontrolle der Situation durch Drohungen
- Veranschaulichung der eigenen Macht
→ Hauptschwelle: Leitung durch moralische und ethische Skrupel.
III. Stufe: "Nur Verlierer"
- 7. Phase: Begrenzte Vernichtungs(-schläge)
- Eigener Schaden wird toleriert, solange der Schaden der Konfliktpartei größer ist
- Konfliktpartei wird nicht länger als Mensch wahrgenommen
- 8. Phase: Zersplitterung
- Vernichtung des "Unterstützersystems" der Konfliktpartei
- 9. Phase: Gemeinsam in den Abgrund
- Eigene Vernichtung wird in Kauf genommen, wenn die Konfliktpartei mit untergeht
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Konfliktparteien zunehmend irrationaler handeln und zukünftige Folgen ihres Handelns und Tuns komplett ausblenden.
Deeskalationsstufenmodell nach Glasl
Auf Basis des Stufenmodells der Eskalation hat Friedrich Glasl eine Art Stufenmodell der Deeskalation abgeleitet. Dabei hat er jeder der neun Phasen verschiedene Konfliktbewältigungsstrategien zugeordnet. In jeder Phase können theoretisch mehrere Strategien angewandt werden, jedoch kann eine falsche Wahl zu Unzufriedenheit und Enttäuschung führen. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Deeskalation als unproduktiv erlebt wird und die Konfliktparteien nicht weiter an einer Lösung des Konflikts interessiert sind.
| Phasen | Merkmale |
| Phasen 1 bis 3: Moderation | - Die Konfliktparteien sind noch in der Lage, die Auseinandersetzung ohne einen Eingriff von außen (durch Dritte) zu lösen.
- Noch ist es möglich, den Konflikt in gemeinsamem Einverständnis beizulegen und im besten Fall sogar mit einem positiven Nutzen für beide Parteien aus dem Streit herauszugehen. Das ist besonders dann der Fall, wenn beide Parteien die Position des jeweils anderen annehmen und ergänzen.
|
| Phasen 3 bis 5: Prozessbegleitung | - Wechsel des Konflikts von der sachlichen auf die persönliche Ebene.
- Die Konfliktparteien sind nun nicht mehr imstande, die Auseinandersetzung selbst zu lösen. Es braucht Hilfe von außen, z. B. in Form einer sogenannten Prozessbegleitung, um den Streit beiseitezulegen.
- Dabei handelt es sich um eine möglichst neutrale und außenstehende Vermittlerfigur.
|
| Phasen 4 bis 7: Sozio-therapeutische Prozessbegleitung | - Spitzt sich der Konflikt weiter zu, reicht eine reine Moderation nicht mehr aus.
- Gerade wenn sich die Konfliktparteien gegenseitig bedrohen und auch (körperlichen) Schaden androhen, ist eine sogenannte sozio-therapeutische Prozessbegleitung notwendig.
- Dabei handelt es sich um eine Person mit professioneller Ausbildung, die als Vermittler agiert.
|
| Phasen 5 bis 7: Mediation | - Ist der Konflikt schon weiter fortgeschritten und eine Vermittlung mithilfe von Moderation und Prozessbegleitung aussichtslos, kann eine sogenannte Mediation bei der Deeskalation helfen.
- In der Mediation liegt der Fokus auf der Wiederherstellung des Dialogs zwischen den Parteien.
- Das Ziel ist, dass die Konfliktparteien selbst Lösungen entwickeln und der Mediator nur als Hilfestellung fungiert.
|
| Phasen 6 bis 8: Schiedsverfahren | - Eskaliert der Konflikt weiter, kann möglicherweise ein gerichtliches Verfahren vonnöten sein.
- Dabei kann es sich um freiwilliges oder auch unfreiwilliges Schiedsgericht handeln, dessen Ziel darin liegt, eine für beide Parteien verpflichtende Lösung zu finden.
|
| Phasen 7 bis 9: Machteingriff | - Ist der Konflikt bereits so fortgeschritten, dass beide Parteien gewillt sind, ihren eigenen Untergang in Kauf zu nehmen, hilft nur noch der Eingriff durch eine höher gestellte Instanz.
- Die Beendigung des Konflikts erfolgt somit autoritär, also von oben herab.
|
Folgendes (überspitztes) Beispiel soll Dir noch einmal genauer erläutern, was Du Dir unter einer höher gestellten Instanz vorstellen kannst:
Du und Deine Schwester streiten euch darüber, wohin der nächste Familienurlaub gehen soll. Während Du nach Italien fahren möchtest, will Deine Schwester nach Griechenland. Ihr beide seid stark auf euer jeweiliges Reiseziel fokussiert und würdet nicht davon abweichen. Euer Vater hat sich jetzt schon die letzte Woche euren Streit angehört und hat es satt. Er entscheidet nun, dass die Familie nach Griechenland fliegt. Damit hat er, als höhere Instanz, entschieden und Du kannst Dich zwar über seine Entscheidung ärgern, jedoch nichts daran ändern.
Deeskalation – Maßnahmen
Bei der Deeskalation handelt es sich stets um Maßnahmen oder Strategien, um einem Konflikt vorzubeugen oder ihn zu lösen. Und wie es häufig so ist, gibt es nicht nur eine einzige Maßnahme. Deshalb wurden neben dem Stufenmodell im Zuge des Konfliktmanagements im Laufe der Zeit viele weitere Maßnahmen und Strategien zur Deeskalation entwickelt. So auch ein weiteres Stufenmodell der Deeskalation.
Deeskalation – Stufenmodell
Das Stufenmodell der Deeskalation findet vor allem Anwendung im Bereich der Pflege. Dennoch lässt es sich mit ein paar leichten Abwandlungen auf jede andere Art der Eskalation bzw. Deeskalation übertragen. Es lassen sich somit sieben verschiedene Stufen zur Deeskalation finden.
- Stufe: Vermeidung der Entstehung von Gewalt und Aggression
- Stufe: Veränderung der Sichtweisen und Bewertungsprozesse von herausfordernden Verhaltensweisen
- Stufe: Reflexion und Veränderung der eigenen Grundhaltung
- Stufe: Verständnis der Ursache und Beweggründe herausfordernder Verhaltensweisen
- Stufe: Auslöser und Motive der Aggression der Konfliktpartei müssen verstanden werden
- Stufe: verbale Deeskalation – Worte statt Taten
- Stufe: Reflexion der Situation zur Vermeidung ähnlicher Konflikte in der Zukunft
Das Stufenmodell der Deeskalation ist stark darauf ausgerichtet, dass sich jede Konfliktpartei trotz aller Aggression selbst reflektiert und somit einen aktiven Beitrag zur Beseitigung des Konflikts leistet. Jedoch ist das nicht immer leicht, insbesondere, wenn man emotional aufgeladen ist.
Deeskalation – Kommunikation
Die Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle in der Deeskalation. Der Ausgang und die Dauer des Streits sind häufig von der Reaktion und Art der Kommunikation abhängig. Oft lässt sich eine solche Dynamik zwischen pubertierenden Geschwistern finden, wie dieses Beispiel noch einmal verdeutlicht:
Dein großer Bruder liebt es, Dich zu ärgern und zu provozieren. Ob es jedoch zu einem Streit bzw. Eskalation kommt, hängt jedoch stark davon ab, wie Du auf seine Sticheleien reagierst. Schluckst Du seinen Köder und schreist und boxt zum Beispiel zurück, stachelt das ihn mit großer Wahrscheinlichkeit an und er wird Dich noch mehr und stärker ärgern. Wahrst Du hingegen Ruhe und redest beschwichtigend oder reagierst womöglich überhaupt nicht, verliert Dein Bruder schnell das Interesse und der anbahnende Streit wird dadurch deeskaliert.
Kommunikation hat bekanntlich einen großen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft eines Menschen. Wie das Beispiel recht anschaulich gezeigt hat, hat Kommunikation das Potenzial einen Konflikt entweder eskalieren zu lassen oder eben zu deeskalieren. Grundsätzlich ist Kommunikation der Grundpfeiler jeder verbalen Deeskalation. Dieser liegt die gewaltfreie Kommunikation zugrunde.
Mehr über die gewaltfreie Kommunikation bzw. das Vier-Ohren-Modell erfährst Du in der Erklärung "Kommunikationsmodelle".
Verbale Deeskalation
Sprache bzw. verbale Verständigung ist ein zentraler Bestandteil der zwischenmenschlichen Kommunikation und bringt daher mindestens ebenso viele Chancen wie Herausforderungen und Konfliktpotentiale. So sind zum Beispiel die Intonation, also ob jemand laut, leise, tief oder hoch spricht und der Unterton, wie beispielsweise ironisch oder aggressiv, von großer Bedeutung bei der Ausbildung eines Konflikts. Je nachdem, wie die Stimmlage und der Unterton einer Person in einem Gespräch ausfallen, kann das entweder eskalierend oder deeskalierend wirken.
Weitere deeskalierende Maßnahmen
Es gibt eine ganze Bandbreite deeskalierender Maßnahmen. Viele setzt Du wahrscheinlich selbst regelmäßig ein, unabhängig davon, ob Du Dir dessen überhaupt bewusst bist oder nicht. Typische deeskalierende Maßnahmen sind:
- Ruhe bewahren
- Person Zeit geben
- Ortswechsel
- ruhiges Lied summen
- Augenkontakt herstellen
- klare Bitte formulieren
- Verständnis zeigen
- defensive Körperhaltung
Merke Dir jedoch, dass jeder Mensch anders ist und anders auf gewisse Situationen reagiert. Hier hilft häufig ein vorsichtiges Herantasten und Ausprobieren, welche Maßnahmen eine deeskalierende Wirkung haben und welche wiederum eher eskalierendes Potential bergen.
Deeskalation - Das Wichtigste
- Deeskalation ist eine Maßnahme bzw. Methode zur Verhinderung der Entstehung oder Steigerung von Aggression und Gewalt.
- Deeskalation ist das Gegenteil von Eskalation, die die Verstärkung eines Konflikts durch sich wechselseitig anstachelnde Aktionen und Reaktionen meint.
- Das Stufenmodell der Eskalation beschreibt die Zuspitzung eines Konflikts in neun Phasen. Davon lassen sich wiederum Konfliktbewältigungsstrategien, wie die Mediation oder der Machteingriff ableiten.
- Das Stufenmodell der Deeskalation definiert insgesamt sieben verschiedene Deeskalationsstufen.
- Kommunikation besitzt die Macht, sowohl deeskalierend als auch eskalierend zu wirken.